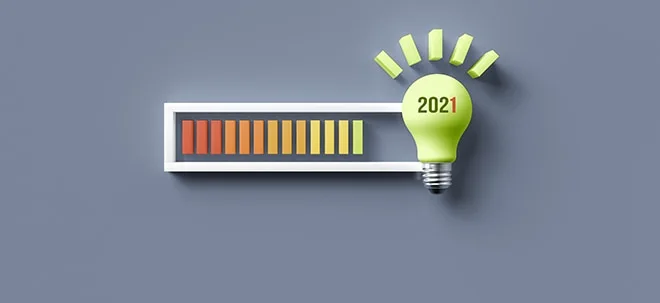Das Jahr 2020 neigt sich seinem Ende entgegen. Niemand wird dieses Jahr vergessen, dazu war es zu einzigartig, schreibt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in ihrem Ausblick auf das kommende Jahr. »Grund zur Kursbestimmung« lautet dazu die gewählte Überschrift.
Viele Menschen dürften froh sein, wenn das laufende Jahr endlich vorbei ist. Denn zu stark haben Krankheit, Beschränkungen des öffentlichen Lebens und wirtschaftliche Lasten dieses Jahr geprägt. Mit Covid-19 ist erhebliches Leid über die Länder der Welt gekommen. Schon jetzt sind mehr als eine Million Menschen im Zusammenhang mit dem Erreger gestorben. In vielen Ländern haben die Behörden »Lockdowns« verhängt und nachfolgend Lockerungen vorgenommen, nur um dann die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erneut zu verschärfen.
Die wirtschaftlichen Folgen sind gravierend, so die LBBW. Die Rezession der Weltwirtschaft 2020 sei, zumindest für die Zeit zurück bis zum Beginn der 1950erJahre, ohne Beispiel. Keines der großen Länder habe sich der Abwärtsspirale entziehen können. China zeige zwar ein kleines Plus für das zu Ende gehende Jahr; aber dies markiere im Endeffekt kein Wachstum, sondern Stagnation - eine herbe Enttäuschung vor dem Hintergrund einer beeindruckenden Wachstumshistorie. Ansonsten stehen vom Euroraum über Großbritannien, Japan oder Indien bis zu den Vereinigten Staaten dicke Minuszeichen in der Tabelle zur realwirtschaftlichen Entwicklung.
Aber nach Einschätzung der LBBW wird das vor uns liegende Jahr 2021 eine Rückkehr zu Wachstum und Prosperität bringen. Volkswirtschaften glichen mitunter einer Stahlfeder in einem Stoßdämpfer: Je stärker die Feder zusammengedrückt werde, desto heftiger springe sie auseinander, sobald der Druck nachlasse. Für das kommende Jahr erwartet man ein gewisses Nachlassen des Drucks. Die Menschheit habe Schritt für Schritt gelernt, mit der Corona-Pandemie umzugehen. Auch die Entwicklung von Impfstoffen sei weit gediehen. Viele forschende Pharmaunternehmen hätten die ersten Stufen im Testprozedere erfolgreich absolviert. Mit einem Impfstoff und perspektivisch mit entsprechenden Medikamenten werde die Seuche zweifelsohne an Schrecken verlieren.
Konkret gibt die LBBW in ihrem Ausblick auf 2021 Einschätzungen zu den Aussichten für Geldpolitik, Anleihemarkt, Devisenmarkt, Rohstoffe, Immobilienmarkt und Aktien. BÖRSE ONLINE berichtet nachfolgend über die Prognosen.
Geldpolitik: Im Zweifel Neigung zu weiterer Lockerung
Welche Pläne die obersten Währungshüter von EZB und Fed zum Jahresstart 2020 auch immer gehabt haben mögen: Diese Pläne warf der Ausbruch der Corona-Pandemie im ersten Quartal schnell und nachhaltig über den Haufen, so die LBBW im Kapital zu den Aussichten für die Geldpolitik. Die weltweite Ausbreitung des neuartigen Virus und speziell die umfassenden Maßnahmen zu dessen Eindämmung hätten einen schweren wirtschaftlichen Schock ausgelöst. Wie bereits in der Finanzkrise sei die Geldpolitik dann erneut zum Ersthelfer in der Not geworden.
Ausgehend von einem Tagesgeldzielband zwischen 1,50 Prozent und 1,75 Prozent zu Jahresbeginn sei die US-Notenbank 2020 in zwei großen, dicht aufeinanderfolgenden Schritten zum faktischen Nullzinsniveau zurückgekehrt; dieses habe bereits zwischen Dezember 2008 und Dezember 2015 gegolten. Zudem habe die Fed im zu Ende gehenden Jahr ihre Bilanzsumme von rund vier Billionen Dollar in nie dagewesenem Tempo bis auf gut sieben Billionen Dollar aufgebläht, hauptsächlich durch den formell unlimitierten Ankauf von US-Staatstiteln. Eine Vielzahl weiterer Kriseninterventionsmaßnahmen habe zwar eine gewisse psychologische Wirkung zur Stabilisierung der Finanzmärkte geleistet, diese hätten aber rein quantitativ betrachtet ein Schattendasein geführt.
Im Euroraum habe die neue EZB-Chefin Lagarde anfangs mit der kommunikativen Herausforderung gefremdelt, den richtigen Ton zur Beruhigung der Finanzmärkte in der Krise zu treffen. Nachfolgend habe sie über einer Ausweitung der EZB-Bilanzsumme um bis dato mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn auf über sechs Billionen Euro präsidiert. Erstes Mittel der Wahl in diesem Zusammenhang seien Anleihekäufe im Rahmen des Notfallprogramms PEPP sowie die Ausreichung stark vergünstigter Langfristkredite an die Geschäftsbanken des Euroraums gewesen.
Neue Maßstäbe habe das PEPP einerseits bezüglich seines Gesamtvolumens von 1.350 Mrd. Euro gesetzt, welches per Ende Oktober 2020 zu rund 50 Prozent ausgeschöpft gewesen sei. Ein wichtiges Signal an die Finanzmärkte sei andererseits die Tatsache gewesen, dass zentrale Restriktionen des »alten« Programms zum Erwerb öffentlicher Anleihen (PSPP) beim PEPP ausgesetzt oder aufgeweicht worden seien; so seien nunmehr die selbstgesetzte Begrenzung des Anteils der Notenbank am ausstehenden Anleihevolumen auf 33 Prozent und die Aufteilung der Käufe nach dem EZB-Kapitalschlüssel entfallen.
Die schweren wirtschaftlichen Folgewirkungen der Corona-Pandemie, unter anderem für die Arbeitsmärkte, und die Risiken, welche hiervon auch langfristig auf die Weltwirtschaft ausgingen, dürften alle großen Notenbanken aus heutiger Sicht für lange Zeit an eine extrem expansive Geldpolitik binden. Zumindest im kommenden Jahr möge sich ein ernsthaftes Überdenken des aktuellen Kurses selbst dann noch nicht einstellen, wenn sich die begonnene Konjunkturerholung im Euroraum und in den Vereinigten Staaten, wie von der LBBW erwartet, als nachhaltig herausstellen sollte. Revisionen der geldpolitischen Strategie, welche die Fed bereits abgeschlossen habe und welche die EZB für das kommende Jahr anpeile, erhöhten die Hürden für eine Abkehr von der faktischen Null- bzw. Negativzinspolitik zusätzlich.
Die US-Währungshüter wollten nach eigener Aussage künftig mehr Inflation tolerieren, bevor sie ihren Leitzins anheben würden. Zu lange und zu kräftig habe die Teuerung in den vergangenen Jahren das Zwei-Prozent-Ziel der Fed unterschritten. Dieser Wert solle künftig nachhaltig und im Durchschnitt über eine längere Zeit wieder erreicht werden. Nach vorliegenden Indikationen aus der Spitze der EZB tendiere deren Zentralbankrat in eine ähnliche Richtung. Ein derartiger Schritt käme faktisch einer Anhebung des bisherigen Inflationsziels von »unter, aber nahe zwei Prozent« gleich.
Wie dies auch nach der Finanzkrise zu beobachten gewesen sei, habe die Corona-Pandemie, zumindest zunächst, in der Summe eher deflationäre Impulse ausgelöst. Dies stelle die Notenbanker beiderseits des Atlantiks vor eine zusätzliche Herausforderung bei der Verteidigung der Glaubwürdigkeit ihrer Inflationsziele. Dabei sei diese Glaubwürdigkeit, nach Maßgabe der Inflationserwartungen am Zinsmarkt, bereits vor der Corona-Krise angegriffen gewesen.
Kurzfristig stünden sowohl bei der EZB als auch bei der Fed wohl Erwägungen im Vordergrund, die Geldpolitik noch expansiver als schon bislang zu gestalten. Mit weiteren Leitzinssenkungen rechnet man zwar nicht; so habe die US-Notenbank eine Einführung von Negativzinsen bis auf Weiteres faktisch ausgeschlossen, während die EZB zunehmend auf ungünstige Nebeneffekte noch tieferer Negativzinsen achten dürfte. Es stehe aber zu erwarten, dass die Euro-Währungshüter das PEPP nochmals aufstocken und dieses bis mindestens Ende 2021 verlängern werde. Die Fed halte sich eine Erhöhung ihres monatlichen Mindestankaufvolumens von derzeit 80 Milliarden Dollar für US-Staatstitel offen. Sie dürfte zudem mit der Option flirten, mittelfristig Zielwerte oder Obergrenzen für die Renditen von US-Staatsanleihen mittlerer oder gar längerer Laufzeiten festzulegen, um Rückenwind für die US-Wirtschaft durch niedrige Zinsen auch im Konjunkturaufschwung dauerhaft zu sichern. Eine solche Politik der »Zinskurvenkontrolle« betrieben bisher nur die Notenbanken Japans und Australiens.
Aus heutiger Sicht dürften sich sowohl die EZB als auch die Fed von ihrer Neigung zu einer nochmals lockereren Geldpolitik frühestens im späteren Jahresverlauf 2021 wegbewegen. Die LBBW erwartet, dass dann zunächst weidlich auf das zentrale Instrument der »Forward Guidance« zurückgegriffen wird, und zwar mittels deutlicher Signale, dass Zinsanhebungen noch für längere Zeit nicht zu erwarten stehen.
Bewegung in Sachen Leitzinsen könnte es unter allen großen Volkswirtschaften im Jahr 2021 am ehesten im Vereinigten Königreich geben - auch hier nicht nach oben, sondern weiter nach unten. Die britische Notenbank erwäge ernsthaft die Einführungen negativer Leitzinsen. Realistische Chancen auf eine Umsetzung dieser Option bestünden vor allem für denjenigen Fall, dass die Volkswirtschaft der Insel weitergehenden Schaden aus dem »Brexit« erfahren sollte.
Rentenmärkte: Ultralockere Geldpolitik versus steigende staatliche Verschuldung
Die Aussichten für die Wertentwicklung als sicher geltender Staatsanleihen waren vor Jahresfrist weder in den USA noch im Euroraum allzu rosig, so die LBBW. Dass die Kurse im ablaufenden Jahr dennoch per Saldo positiv tendiert hätten, vor allem in Übersee, habe zuvorderst an den wirtschaftlichen Verheerungen und der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gelegen. Anleihekäufe von Fed und EZB in historisch beispielloser Höhe und eine zeitweise massive Flucht der Anleger in die Sicherheit hätten die Kurse angetrieben.
In der Hochphase der Corona-Krise seien Staatsanleihen schwächerer Bonität sowie Unternehmensanleihen aus Sorge vor erodierender Zahlungsfähigkeit und steigenden Unternehmensausfällen unter Druck geraten. Im weiteren Jahresverlauf hätten sich diese Verluste dann in vielen Fällen in ihr Gegenteil verkehrt, dank der Notenbanken und einer einsetzenden Konjunkturerholung. So hätten die Renditen langlaufender italienischer Staatstitel im Herbst neue Allzeittiefstände erreicht. Der kurstreibende Impuls der Notenbankkäufe sei dabei nicht zuletzt auf den Effekt zurückgegangen, dass diese die Anleger auf der Suche nach Rendite fast zwangsläufig in riskantere Wertpapiere getrieben hätten.
Die Jagd der Anleger nach Rendite dürfte auch im kommenden Jahr ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Rentenmärkte bleiben. Wesentliche Änderungen am geldpolitischen Umfeld seien beiderseits des Atlantiks auf absehbare Zeit im Grundsatz nicht zu erwarten. Wegen hoher Corona-Risiken gehe die Tendenz zunächst im Zweifel zu weiteren geldpolitischen Lockerungen. Viel Spielraum hierfür bestehe dabei nun nicht mehr, sodass die Aussichten für die Renditen sichererer Staatsanleihen im Jahr 2021 auf den ersten Blick insgesamt recht statisch erscheinen würden, entsprechend einer ausgedehnten Bodenbildung.
Angesichts von aktuell im historischen Vergleich extrem hoher Bewertungen, welche bei sicheren Staatstiteln erreicht worden seien, drohten durchaus Verlustrisiken. Dies gelte speziell für den Fall von Hinweisen, welche Zweifel an einem langanhaltenden Fortbestehen des Niedrigzinsumfelds säen würden. Ein schnelles Überwinden der Corona-Krise, verbunden mit einer dynamischen Fortsetzung der begonnenen Konjunkturerholung, zähle hierzu. Gleiches gelte für ein spürbares Wiederanziehen der Inflation. Diese sei im Euroraum im Spätsommer 2020 in den negativen Bereich hinabgetaucht, was am Markt und bei der EZB Sorgen vor deflationären Tendenzen geweckt habe.
In den Vereinigten Staaten habe derweil eine Debatte über eine Reflationierung nach der Krise eingesetzt. Dies stehe mit dem vielleicht größten potenziellen Risikofaktor für den Rentenmarkt in Verbindung, nämlich mit einer steil ansteigenden Staatsverschuldung in allen westlichen Industriestaaten. Dieser Trend ähnele der Entwicklung nach der Finanzkrise, allerdings ausgehend von bereits deutlich erhöhten Schuldenständen in Relation zur Wirtschaftsleistung. Im Zuge der Corona-Krise dürften die Kennziffern in zahlreichen Staaten teils deutlich über die Marke von 100 Prozent steigen. Zu Recht fürchteten viele am Staatsanleihemarkt, dass sie auf mittlere bis längere Sicht zum Abtragen der Krisenkosten in erheblichem Maße beitragen werden müssen.
Ein gangbarer Weg führe über dauerhaft negative Realrenditen für sichere Staatsanleihen aller Laufzeiten. Die großen Notenbanken sorgten dabei faktisch dafür, dass die nominalen Anleiherenditen, ungeachtet eines anhaltend hohen oder weiter steigenden Staatsanleiheangebots, auch bei anziehender Inflation allenfalls gemäßigt nach oben ziehen würden. Speziell in Übersee könnte die Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten zwar zeitweise Aufwärtsdruck auf die US-Staatsanleihen-Renditen auslösen, weil die Demokraten noch mehr als die Republikaner für eine Akzeptanz dauerhaft hoher Haushaltsdefizite stünden.
In der Summe sollte der dämpfende Einfluss der Fed aber überwiegen, was die Renditen langlaufender US-Treasuries einstweilen unter einem Prozent halten dürfte. Diesseits des Atlantiks dürfte sich die Rendite der marktführenden zehnjährigen Bundesanleihen zwar nur graduell von ihrem aktuellen Niveau um die -0,50 Prozent nach oben entfernen. Die Risiken würden aber auch bei deutschen Staatstiteln aus Anlegersicht die Chancen überwiegen. Etwas besser sähen die Ertragsaussichten im Jahr 2021 bei Unternehmensanleihen.
Devisenmarkt - Euro-Stärke dürfte sich fortsetzen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach hat der Euro im zu Ende gehenden Jahr gegenüber dem US-Dollar eine zuvor fünf Jahre währende Phase der Bodenbildung zu einem Abschluss gebracht, nimmt die LBBW an. Die Gründe seien nicht bei der EZB zu suchen, sondern bei der US-Notenbank und bei den politischen Entscheidern dies- und jenseits des Atlantiks. Als Reaktion auf die grassierende Corona-Krise sei die Federal Reserve im zweiten Quartal auf einen Nullzins-Kurs eingeschwenkt, garniert mit umfangreichen Anleihekäufen.
Noch gewichtiger nach dem Dafürhalten der Analysten: Im Sommer hat die Fed ihre geldpolitische Strategie abgeändert. Dies werde, wenn die Anzeichen nicht trügen würden, dazu führen, dass sie mit Blick auf die weitere Zukunft deutlich zögerlicher mit einer Straffung ihrer Geldpolitik beginnen werde und die Zinsen insgesamt niedriger bleiben dürften als nach früheren Reaktionsmustern. Daneben habe im Herbst die sich zunehmend abzeichnende Wahl Joe Bidens, des Demokratischen Bewerbers um das Amt des US-Präsidenten, den Außenwert des »Greenback« negativ tangiert.
Der Euro müsse sich an seine neuerliche Attraktivität am Devisenmarkt erst wieder gewöhnen. Seit 2015 habe ihm dort ein Malus angehangen. Auslöser sei der Beschluss der EZB-Oberen gewesen, in großem Umfang Anleihen der Euroraum-Mitgliedsstaaten aufzukaufen und das Geldmengenwachstum weiter zu befeuern. Die Renditedifferenz zwischen Euro- und US-Dollar-Anleihen hätten sich in der Folge weiter zuungunsten des Euro verschoben. Der Schritt habe damals, sozusagen als Kollateralschaden, die Schweizerische Nationalbank zu einer Art »Kapitulation« gezwungen: Sie habe die Verteidigung ihres Mindestwechselkurses von 1,20 Schweizer Franken je Euro aufgegeben, eine Regel, die zuvor mehr als drei Jahre bestanden habe.
Das gewichtigste Argument für die aktuelle Euro-¬Stärke ist aus Sicht der LBBW in einem jüngst aufgeschlagenen, neuen Kapitel der europäischen Integration zu suchen. Die Einigung der EU-Staaten auf einen »Wiederaufbaufonds« in Reaktion auf die Corona-Krise bewirke, dass die EU zukünftig als große Anleihe-Emittentin am Markt präsent sein werde. Die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Euro-Mitgliedsstaaten seien nunmehr fester zementiert. Mahner wie Bundesbank-Chef Weidmann und Bundeskanzlerin Angela Merkel pochten darauf, dass das Anleiheprogramm der EU auf diesen einmaligen Krisenfall beschränkt bleiben müsse. Derweil frohlockten SPD-Kanzlerkandidat Scholz und EZB-Chefin Lagarde, dass die Gemeinschaft ein neues mächtiges Instrument in die Hand bekommen habe, auch für künftige Fälle. Für den Erhalt des Euro dürften in Zukunft im Zweifelsfall große Geschütze aufgefahren werden. Ein EU-Finanzministerium zeichne sich am Horizont ab, Gegengewicht zur mächtigen EZB.
Die Erholung des Euro gegenüber dem US-Dollar dürfte sich 2021 fortsetzen. Per Jahresende erwartet man einen Kurs von 1,23 US-Dollar je Euro. Gegenüber dem Schweizer Franken habe der Euro zuletzt deutlich verhaltener zugelegt - in Krisenzeiten wie aktuell sei der Franken nach wie vor als ein Hort der Stabilität gesucht. Die Schweizerische Nationalbank habe 2020 wiederholt am Devisenmarkt interveniert, um eine weitergehende Franken-Aufwertung zu verhindern. Sollte die Corona-Pandemie im neuen Jahr, wie von der LBBW postuliert, überwunden werden oder zumindest nicht mehr wesentlich die Wirtschaft belasten, dürfte der Aufwertungsdruck auf den Franken nachlassen. Man geht davon aus, dass Ende kommenden Jahres 1,13 Schweizer Franken für einen Euro bezahlt werden.
Das Britische Pfund sei 2020 am Devisenmarkt gleich von zwei Seiten »in die Zange genommen« worden. Zum einen habe auf ihm die Aussicht gelastet, dass das Vereinigte Königreich zum Jahresende ohne einen weitreichenden Handelsvertrag mit der EU dastehen könnte. Zum anderen habe die Corona-Pandemie die Insel zeitweise verheerend getroffen. Ein zunächst zögerliches und dann umso heftigeres Agieren seitens der Regierung in London zur Eindämmung des Infektionsgeschehens habe bewirkt, dass die Wirtschaft jenseits des Kanals in eine im internationalen Vergleich heftige Rezession gestürzt sei. Der »Brexit« werde noch auf Jahre hinaus die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs beeinträchtigen. Für die Landeswährung sieht die LBBW ganz kurzfristig die Gefahr einer nochmaligen Abwertung in Richtung 0,95 Pfund je Euro. Für die Zeit danach geht man dann von einer gewissen Stabilisierung der britischen Valuta aus. Hierfür spreche nicht zuletzt, dass diese ohnehin bereits niedrig bewertet sei. Dies zeige etwa die Kaufkraftparität an. Im Verlauf des kommenden Jahres sollte das Britische Pfund um ein Niveau von 0,92 Pfund je Euro schwanken.
Rohstoffe - Konjunkturerholung bringt Rückenwind
Im Zuge der Corona-Krise gaben die Preise am Rohstoffmarkt im ersten Viertel des zu Ende gehenden Jahres um durchschnittlich rund 25 Prozent nach, konstatiert die LBBW. Der Bloomberg Commodity Index (Spot) sei im März fast bis auf Niveaus gesunken, wie sie zuvor letztmalig 2009 und 2015/16 erreicht worden seien. Ab dem zweiten Quartal sei es dann mit den Rohstoffpreisen Schritt für Schritt nach oben gegangen. Im Oktober habe der Bloomberg Index mit gut 370 Punkten einen neuen Jahreshöchststand erreicht. Da die Weltwirtschaft nach Erachten der LBBW im kommenden Jahr zulegen dürfte, sei für die meisten Rohstoffe für 2021 mit einer Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends zu rechnen.
Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus habe zunächst zu einem drastischen Einbruch der Ölnachfrage geführt. Für 2020 insgesamt dürfte diese gegenüber dem Vorjahr um acht Millionen Fass pro Tag (mbpd) fallen. Brent sei vor diesem Hintergrund Mitte April bis auf 16 Dollar je Fass abgestürzt; für West Texas Intermediate (WTI) hätten sich kurzzeitig sogar negative Preise ergeben. Die OPEC-Staaten, ergänzt um verbundene Förderländer wie Russland und Mexiko, hätten als OPEC+ mit massiven Förderkürzungen reagiert. Seit Mitte 2020 ziehe die Ölnachfrage langsam wieder an. Für die zweite Hälfte des auslaufenden Jahres sei mit einem Angebotsdefizit am Ölmarkt von rund vier mbpd zu rechnen. Mit einer weiteren Erholung der Weltwirtschaft dürfte die Ölnachfrage 2021 recht deutlich um rund fünf mbpd zulegen, während das Angebot vorerst weiter beschränkt bleiben dürfte. Vor diesem Hintergrund seien weiter steigende Rohölpreise wahrscheinlich. Bis Ende 2021 dürfte Brent auf 50 Dollar je Fass zulegen.
Ängste vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, ein schwächerer US-Dollar und extrem hohe Käufe sogenannter »Exchange Traded Commodities« (ETCs) hätten den Goldpreis im Frühjahr und im Sommer 2020 haussieren lassen. Anfang August sei mit 2.075 US-Dollar ein neuer Höchststand erreicht worden. Auf der Nachfrageseite hätten vor allem die physisch hinterlegten ETCs ihre Käufe ausgeweitet. Diese hätten ihre Gold-Bestände von Januar bis Ende Oktober um rekordhohe 34 Prozent bzw. 870 Tonnen aufgestockt. Die meisten anderen Komponenten der Nachfrage hätten sich aber schwach entwickelt. So habe in den ersten neun Monaten des Jahres die Schmucknachfrage mit nur 860 Tonnen um rund 40 Prozent niedriger als 2019 gelegen. Die Notenbanken hätten im selben Zeitraum über 50 Prozent weniger als im Jahr zuvor gekauft, und die industrielle Nachfrage sei knapp zwölf Prozent tiefer gelegen. Insgesamt gesehen dürfte die Goldnachfrage 2020 um rund zehn Prozent oder mehr als 430 Tonnen gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. Ein vermutlich weiter niedriges Zinsniveau möge den Goldpreis in den kommenden Monaten zwar nach unten absichern. Da aber kaum davon auszugehen sei, dass die ETCs das Tempo ihrer Gold-Käufe aufrechterhalten werden, dürfte der Gold-Hausse 2021 langsam die Luft ausgehen. Per Ende 2021 rechnet man mit Preisen von 1.800 Dollar pro Feinunze.
Für Silber sei es 2020 im Preis noch stärker nach oben als für sein gelbes Pendant gegangen. Während der Goldpreis von Mitte März bis Anfang August um gut 40 Prozent zugelegt habe, sei der Silberpreis im selben Zeitraum um mehr als 150 Prozent gestiegen. Das weltweite Angebot an Silber dürfte 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund sieben Prozent oder knapp 70 Millionen Unzen fallen. Demgegenüber dürfte die Nachfrage, die ETCs herausgerechnet, um fast 170 Millionen Unzen oder knapp 17 Prozent einbrechen. Den sich damit abzeichnenden Angebotsüberschuss kompensierten bislang die physisch hinterlegten Silber-ETCs, hätten diese doch ihre Bestände von Anfang Januar bis Ende Oktober um 46 Prozent bzw. 280 Millionen Unzen aufgestockt. Allerdings habe die Dynamik der ETC-Nachfrage zuletzt deutlich nachgelassen. Bei Licht besehen hätten sich die ETC-Bestände seit Ende August 2020 sogar verringert. Sofern die ETCs nicht wieder auf die Käuferseite wechselten, dürften bei Silber niedrigere Preise ins Haus stehen. Man rechnet per Ende 2021 mit Preisen von 18 Dollar je Unze.
Immobilien - Trotz Rezession als Anlageklasse gesucht
Die heftige Rezession im Zuge der aktuell grassierenden Corona-Pandemie und aufgrund der Maßnahmen zu deren Eindämmung habe deutliche Auswirkungen auf den deutschen Immobilienmarkt gehabt. Die Anzahl der Arbeitslosen sei gestiegen, und viele Unternehmen kämpften um ihre Existenz. Sowohl für Gewerbe- als auch Wohnimmobilien hätten sich die fundamentalen Rahmenbedingungen verschlechtert. Im Detail seien die Auswirkungen auf die einzelnen Marktsegmente dabei sehr unterschiedlich, und es seien auch positive Effekte zu beobachten.
Zwar habe die Wirtschaft in Deutschland im dritten Quartal viel vom Einbruch im Vierteljahr zuvor nachgeholt. Diese Stabilisierung stehe aber auf wackligen Füßen. Neuerliche Corona-Eindämmungsmaßnahmen setzten für den bevorstehenden Winter ein dickes Fragezeichen hinter die begonnene Erholung. Die Realwirtschaft sei noch nicht über den Berg. Eine verschlechterte Erwerbslage sowie Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz dürften für sich genommen in der Bevölkerung zu einem nachlassenden Kaufinteresse nach Wohnimmobilien führen.
Auch biete die demografische Entwicklung dem Wohnungsmarkt aktuell keine Unterstützung. Aufgrund eingeschränkter Reisemöglichkeiten falle die Zuwanderung im laufenden Jahr geringer aus als zuvor. Erstmals seit 2010 sei im ersten Halbjahr 2020 die Bevölkerung in Deutschland geschrumpft. Die Zuwanderung sei in der Vergangenheit insbesondere den Metropolen und Schwarmstädten zugutegekommen. Sollte die Corona-Pandemie im Laufe des kommenden Jahres an Brisanz verlieren, dürfte die Nettozuwanderung nach Deutschland wieder höher ausfallen, zumal die Wirtschaft in Deutschland die Krise, nicht zuletzt dank staatlicher Unterstützung, besser überstehen sollte als in vielen anderen Staaten Europas. Für die kommenden Jahre rechnet die LBBW mit einer wieder leicht wachsenden Bevölkerung.
In den vergangenen zehn Jahren seien die Preise für Wohnungen in Städten mit wachsender Bevölkerung erheblich stärker gestiegen als in jenen mit einer schrumpfenden Bevölkerung. Diese Spreizung dürfte sich grundsätzlich fortsetzen. Die Corona-Pandemie mache aus einer bislang wenig attraktiven Stadt nicht plötzlich eine attraktive. So würden wohl auch künftig Regionen mit starker Wohnungsknappheit neben Regionen mit einem Überfluss an Wohnraum existieren. Gewisse Verschiebungen seien gleichwohl zu erwarten. Man rechnet mit künftig weniger starken Wanderungsbewegungen als in den zurückliegenden zehn Jahren. Dadurch sollte der Rückenwind für Metropolen und beliebte Universitätsstädte geringer werden.
Zudem dürfte die Ausweitung von Homeoffice den Markt für Wohnimmobilien beeinflussen. Auch wenn einstweilen nur schwer abzusehen sei, wie stark die Möglichkeit, von Hause aus zu arbeiten, künftig genutzt werde, so dürfte der Trend in diese Richtung vorgezeichnet sein. Dies bedeute grundsätzlich eine Aufwertung des Wohnens. Erstens verbrächten die Menschen nun mehr Zeit in ihren »vier Wänden«, und zweitens benötigten sie gegebenenfalls mehr Fläche, um sich einen adäquaten Arbeitsraum einzurichten. Für Menschen mit der Möglichkeit zum Homeoffice werde es daneben weniger wichtig, nahe bei ihrem Arbeitsplatz zu wohnen, da sie nicht mehr so häufig pendeln müssten. Dies dürfte die »Speckgürtel« um große Städte herum, relativ betrachtet, an Attraktivität gewinnen lassen, zumal die Wohnungspreise und Mieten dort im Allgemeinen niedriger seien.
Verlierer des Trends zu mehr Homeoffice dürften, wenig überraschend, die Büroimmobilien sein. Von einer extremen Belastung hierdurch geht die LBBW aber nicht aus. In vielen Fällen werde Homeoffice wohl nur eine Ergänzung zum Arbeiten im Büro und nicht einen kompletten Ersatz darstellen. Zudem habe die Corona-Krise den Markt für Büroimmobilien in einer Phase getroffen, in der er ohnehin mehr und mehr Gefahr gelaufen sei zu überhitzen. Die Leerstandquoten seien, sowohl im historischen als auch im internationalen Vergleich, niedrig. Nun könnten sie ansteigen - vor allem aufgrund einer geringeren Beschäftigung und zu erwartender Unternehmensinsolvenzen. Insgesamt dürfte der Anstieg der Leerstände für den Markt zu verkraften sein.
Daneben habe die Corona-Krise den Trend zur Nutzung des Online-Handels verstärkt. Dies setze etablierten Einzelhändlern zu. Dabei dürften sich Geschäfte mit Artikeln des täglichen Bedarfs wie Supermärkte oder Drogerien als relativ robust erweisen. Insofern fächere sich der Markt für Einzelhandelsimmobilien weiter auf. Profiteure des Online-Handels seien die Logistikimmobilien.
Trotz des fundamentalen Gegenwinds seien die Preise für Wohnimmobilien nach aktuellem Stand der Daten bis zuletzt weiter gestiegen: ein Phänomen, dass für viele Länder zu beobachten sei. Wesentlicher Grund dafür dürfte sein, dass Wohnimmobilien zwar eine eher risikoarme Kapitalanlage darstellten, gleichzeitig aber eine höhere Rendite ermöglichten, als sie mit sicheren Anleihen erzielbar seien. Angesichts einer extrem expansiven Geldpolitik und spätestens seit der jüngsten Neuausrichtung der US-Notenbank habe das Zeitalter der realen Assets begonnen. Unattraktive Zinsen dürften auch künftig dafür sorgen, dass Anleger von den Anleihemärkten auf andere Anlageformen ausweichen würden. Die Entkopplung im Wachstum zwischen Geldmenge und Realwirtschaft, wie wir es bereits seit vielen Jahren erleben würden und sich dies auch auf absehbare Zeit fortsetzen dürfte, spreche ebenfalls dafür, Sachwerten ein größeres Gewicht bei der Kapitalanlage zu geben. Auch nach vorn blickend dürfte die Geldpolitik wohl vor allem die Vermögenspreise und weniger die Konsumentenpreise in die Höhe treiben.
Aufgrund gestiegener relativer Attraktivität geht man für die kommenden Jahre von weiter steigenden Preisen für Wohnimmobilien aus, wenngleich die Entwicklung auch künftig maßgeblich vom konkreten Standort abhängen dürfte. Wie bereits dargestellt möge sich die Wohnungsknappheit in den Ballungszentren, nach vorne blickend, etwas entschärfen. Aufgrund verschlechterter fundamentaler Rahmendaten sowie eines bereits erreichten erhöhten Bewertungsniveaus geht man für den Markt aber insgesamt von geringeren Preissteigerungsraten als in den zurückliegenden Jahren aus.
Aktien - Von der Liquidität als Treiber hin zu den Gewinnen
Hakte so mancher Börsianer im Sommer des ablaufenden Jahres Covid-19 gedanklich schon ab, zeigt die seit Ende der Sommerferien wütende zweite Infektionswelle plastisch, dass sich das Corona-Gespenst so schnell nicht verjagen lässt, konstatiert die LBBW. Noch dürften einige Monate ins Land ziehen, bis flächendeckende Impfungen möglich seien. Speziell in Europa habe sich die Politik angesichts exponentiell ansteigender Neuinfektionen jüngst nicht mehr anders zu helfen gewusst, als neuerlich »Lockdown«-ähnliche Regime einzuführen. Die Realwirtschaft sollte zwar insgesamt weiterlaufen; deren Dynamik werde jedoch abgebremst, nicht zuletzt in den von den Eindämmungsmaßnahmen schwerpunktmäßig betroffenen Dienstleistungsbereichen.
Trotz Corona: Die Analystenzunft prognostiziere für den US-Blue-Chip-Index S&P 500 für das Jahr 2021 im Konsens einen Gewinn leicht oberhalb des Vorkrisenniveaus von 2019. Für den DAX werde sogar ein deutlicher Gewinnanstieg erwartet. Für den Euro Stoxx 50 werde demgegenüber davon ausgegangen, dass das Gewinnniveau im kommenden Jahr nicht ganz an das Niveau des Vorjahres heranreichen wird. Nach den Erwartungen der LBBW wird die Weltproduktion erst in der zweiten Hälfte des neuen Jahres, in Europa sogar wohl erst im Jahr 2022, das Niveau der Zeit unmittelbar vor der Krise einholen. Insofern hält man die derzeitigen Aktiengewinnschätzungen für zu optimistisch. Insbesondere für das erste Halbjahr 2021 geht man von sichtbaren Gewinnrevisionen abwärts aus. Absolut betrachtet sollten die Gewinne 2021 jedoch wieder höher ausfallen als 2020, weshalb man davon ausgeht, dass die nach vorne blickenden 12-Monats-Forward-Gewinne in der Tendenz nun wieder steigen werden.
Die Aktiengewinne würden im Euro Stoxx 50 seit dem Jahr 2002 nicht mehr so tief ausfallen wie aktuell. Im DAX seien sie zuletzt auf das Niveau von 2013 zurückgefallen. Die Gewinne im S&P 500 könnten sich zumindest mit denen des Jahres 2017 vergleichen. Derweil hätten sich die Aktienindizes von ihren Einbrüchen des zweiten Quartals zu einem Gutteil erholt. Der wesentliche Grund: die Wirtschaftspolitik mit ihren Corona-Hilfspaketen jedweder Art und mit einer immensen Liquidität der Notenbanken rund um den Globus. Technisch formuliert: Die eng gefasste Geldmenge M1 sei dem Wachstum der Volkswirtschaft sprunghaft enteilt. Liquidität sei im Überfluss vorhanden, was den Assetpreisen zugutegekommen sei, allen voran den Aktienkursen. Der Negativeffekt der eingebrochenen Gewinne sei mühelos wettgemacht worden.
In den USA sei der Liquiditätseffekt speziell beim S&P 500 nicht nur weit höher aus als hierzulande ausgefallen; vielmehr habe er sogar den negativen Gewinneffekt deutlich überstiegen. Dies habe das als neutral empfundene Indexniveau steigen lassen. Im DAX habe der Liquiditätseffekt wenigstens den aus den sinkenden Gewinnen resultierenden Negativeffekt egalisiet. Demgegenüber sei im Euro Stoxx 50 als Ergebnis aus beiden Teileffekten ein deutliches Minus geblieben. In Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich, den Niederlanden oder Belgien habe das Virus weit schlimmer als andernorts gewütet. Entsprechend einschneidend habe sich im Euro Stoxx 50 ein extrem negativer Gewinneffekt ausgewirkt.
Mit Blick auf das neue Jahr habe der Liquiditätseffekt eine Kehrseite: Es stehe zu erwarten, dass das Geldmengenwachstum nachlassen wird. Umgekehrt sollte die Realwirtschaft anhaltend zu Wachstum zurückfinden. In der Konsequenz möge die Überschussliquidität auf Sicht deutlich sinken. Für die Aktienmärkte wäre dies tendenziell negativ. Der von der LBBW erwartete Anstieg der 12-Monats-Forward-Gewinne sollte dies jedoch ausgleichen. Dabei könnte sich der Übergang von der liquiditätsgetriebenen Erholungsrally zu einem von Gewinnen getragen Markt als holprig und als nicht friktionsfrei erweisen.
Die US-Notenbank dürfte mit ihrem jüngsten geldpolitischen Strategieschwenk das bestehende Niedrigzinsumfeld auf unbestimmte Zeit zementiert haben. Die relative Attraktivität von Aktien speziell gegenüber Anleihen dürfte zunächst Bestand haben. Zur Messung dieser Attraktivität werde oftmals die Dividendenrendite von Aktien mit der Rendite von Anleihen verglichen. Dabei schütteten Unternehmen regelmäßig nur einen Teil ihrer Gewinne als Dividende aus. Aussagekräftiger erscheine so gesehen ein Vergleich zwischen Anleiherendite und Gewinnrendite des Aktienmarktes. Letztere sei nichts anderes als das inverse Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Falle eines KGVs von 10 liege die Gewinnrendite des Aktienmarktes bei 10 Prozent, im Falle eines KGVs von 20 nur bei fünf Prozent. Um darüber hinaus mit vergleichbaren Bonitäten zu arbeiten, sollte die Gewinnrendite des Aktienmarktes nicht so sehr Renditen von Staatsanleihen gegenübergestellt werden, sondern der Rendite eines Korbs an Unternehmensanleihen (Corporates). Eine Anlage in Aktien sei aus Sicht eines Anlegers dann attraktiv, wenn die Differenz aus Gewinn- und Corporate-Rendite mindestens so hoch ausfällt, dass sie als Äquivalent für das höhere Risiko einer Aktienanlage zu werten sei.
Die LBBW-Analysten stellen fest: Sowohl für Europa als auch für die Vereinigten Staaten gilt dieser Tage, dass der Renditeaufschlag zugunsten der Aktien aktuell markant höher ausfällt als im langjährigen Mittel. Im Klartext: Die derzeit am Aktienmarkt vorherrschenden Bewertungen mögen hoch erscheinen, und Corona möge vielerorts die Gewinnrenditen gedrückt haben. Dennoch werde das höhere Risiko einer Aktienanlage gegenüber dem Rentenmarkt derzeit weit überdurchschnittlich entlohnt. Auf absehbare Zeit dürfte das »TINA«-Argument greifen: »There Is No Alternative«.
Zwei Themen hätten im Jahr 2020 die Dispositionen im Hinblick auf Risikoassets dominiert. Neben der Corona-Pandemie sei dies, vergleichsweise spät im Jahr, die US-Präsidentschaftswahl gewesen. Die Unsicherheit, mit welchem Präsidenten und mit welcher Agenda es in den Vereinigten Staaten ab dem kommenden Jahr weitergehen würde, habe sich mit Unsicherheiten aus dem Pandemiegeschehen überlagert. Die Erfahrung lehre, dass die Marktteilnehmerinnen und -teilnehmer regelmäßig erst lernen müssten, eine neue US-Administration einzuschätzen. Speziell im ersten Amtsjahr eines US-Präsidenten schwankten die Aktienkurse regelmäßig außergewöhnlich stark, insbesondere dann, wenn der Präsident gewechselt habe und es zu vielen Gesetzesänderungen komme.
Entsprechend dürfte im Jahr 2021 von Interesse sein, inwieweit der neu gewählte Präsident Joe Biden seine Agenda umsetzen könne. Einiges hieraus würde die Unternehmen belasten, wie eine anvisierte Erhöhung des Mindestlohnes oder eine in Aussicht gestellte Anhebung der Unternehmenssteuern. Manches wiederum würde der pandemie-geplagten US-Wirtschaft helfen, wie der von Joe Biden angestrebte »New Green Deal«. Vor diesem Hintergrund werde spannend sein, ob die Demokraten neben der Präsidentschaft und der Mehrheit im Repräsentantenhaus auch die Mehrheit im Senat gewinnen - dies werde sich im Januar in Stichwahlen entscheiden.
Für Anleger mit einem Mittelfristhorizont seien Aktien nicht nur in Relation zu Anleihen attraktiv, sondern auch absolut betrachtet. Dies illustriert man am LBBW-DAX-Fünf-Jahres-Modell. Dieses basiert auf zwei Faktoren. Erstens spiegelt die Dividendenrendite des DAX die Ertragssituation börsennotierter Unternehmen wider. Zweites geht der Quotient aus zusammengefasstem Börsenwert der DAX-Unternehmen zur Geldmenge M3 als Bewertungskomponente in das Modell ein. Jenes ist seit rund 16 Jahren im Echteinsatz. Es hat sich in dieser Zeit laut LBBW als stichhaltiger Gradmesser der Aussichten am Aktienmarkt erwiesen. Das Modell avisiert für die kommenden fünf Jahre eine DAX-Performance von mehr als sieben Prozent p.a. an. Das Modell mache allerdings keine Aussage darüber, wie sich diese Performance auf den Gesamtzeitraum verteile, also auch nicht darüber, ob der DAX zunächst weiter steigen oder doch zwischendurch deutlich fallen wird! Trotz einer historisch hohen Prognosequalität des Modells lasse sich zwar nicht ausschließen, dass dieses die Zukunft zu rosig einschätze. Aber selbst dann, wenn man auf die avisierte Performance einen deutlichen Abschlag in Höhe von zwei bis drei Prozentpunkten vornehmen würde, schlügen Aktien die Anleihen auf Sicht weiterhin.

 Mein Konto
Mein Konto