Der Name klingt verheißungsvoll: "Libra" hat Facebook seine Digitalwährung getauft. 2020 soll sie an den Start gehen. Im Lateinischen steht das Wort für das Sternzeichen Waage, ein Symbol für Gerechtigkeit. Und die Wortwurzel "lib" geht auf "liber", also "frei", zurück. Klingt gut. Darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter dem Digitalgeld knallharte privatwirtschaftliche Interessen stehen. Und dass es mit erheblichen Risiken für die Anleger und die Finanzstabilität verbunden ist.
Im Juni hat Facebook Libra offiziell vorgestellt. Genau genommen war es die Genfer Libra Association (LA), zu der neben Facebook Firmen wie Visa, Uber oder Vodafone gehören. Seitdem sind Politiker, Notenbanker, Finanzaufseher und Ökonomen alarmiert. Denn das Papier skizziert ein Währungssystem, das Euro und Dollar das Wasser abgraben könnte - und das unter Führung eines Techriesen, der in den USA gerade erst zu einer Fünf-Milliarden-Dollar-Strafe wegen Datenmissbrauchs verdonnert wurde. Die Libra-Pläne werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Klar ist, dass die über zwei Milliarden Kunden künftig über ihren Facebook-Account Geld überweisen sollen. Dazu müssen sie eine virtuelle Brieftasche befüllen, indem sie Libra-Coins kaufen, deren Wert an klassische Währungen gekoppelt wird. Die Einzahlungen der Libra-Käufer bunkert die LA in vollem Umfang als Reserve in liquiden Vermögensklassen wie kurz laufenden Staatsanleihen. Das ist der gravierende Unterschied zum Bitcoin, der ebenfalls auf der Blockchain-Technologie basiert, aber ohne Sicherheiten arbeitet.
Libra wäre wohl wertstabiler als der chronisch volatile Kryptoklassiker, aber längst kein sicherer Hafen. Denn es lassen sich eine Reihe von Risiken auflisten. Das fängt schon damit an, dass Libra kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Händler dürfen die Annahme verweigern. Zugleich fehlt eine Garantie der LA, Libra zurückzutauschen. Heikel sind zudem Wechselkursrisiken. Das disqualifiziert Libra als Instrument für den Werterhalt und macht ihn zum Spekulationsobjekt. Und auch als Anlage ist das Facebook-Geld ungeeignet: Zinsen gibt es nicht, weil die LA Erträge aus ihren Anlagen selbst einstreicht.
"Finger weg von Facebooks Währung" war kürzlich ein Beitrag von Peter Bofinger überschrieben. Der frühere Wirtschaftsweise warnt vor den Gefahren von Libra, die umso wirkmächtiger wären, je intensiver die Währung genutzt würde. Schätzungen zufolge könnte die Libra-Reserve zu einem Geldmarktfonds mit dreistelligem Milliardenvolumen anschwellen. Eine Stiftung unter dem Einfluss von Facebook und anderen Digitalkonzernen wäre dann Betreiber einer gigantischen Schattenbank. Brenzlig würde es, wenn es zum massenhaften Rücktausch von Libra käme. Dann müsste die LA große Staatsanleihebestände abstoßen, um die Anleger auszuzahlen. Infolge solcher "Fire Sales" würden die Kurse der Papiere abrutschen, was wiederum andere Investoren belasten würde. Im umgekehrten Fall tritt die LA am Anleihemarkt in Konkurrenz zu Notenbanken und institutionellen Investoren. Dann steigen die Kurse der Papiere, und der Druck auf die Niedrigzinsen nimmt weiter zu.
Es ist gut, dass die Finanzminister beim letzten G-7-Gipfel beschlossen haben, ein Auge auf Libra zu haben. Gut ist auch, dass sich die Bankenaufseher Libra intensiv anschauen wollen. Entscheidend wird sein, wie die Libra-Stiftung sich mit ihrer Kryptowährung positioniert - als Bank oder eben als gigantische Schattenbank. Meine Position ist klar: Wer bankähnliche oder bankgleiche Dienstleistungen im Zahlungsverkehr anbietet, der muss sich den Regelungen unterwerfen, die für Kreditinstitute gelten. Standards der Bankenregelungen sind einzuhalten, zum Beispiel mit Blick auf Geldwäsche und Datenschutz. Will die LA das nicht, sollte man im eigenen Interesse die Finger von der Facebook-Währung lassen.
Zur Person
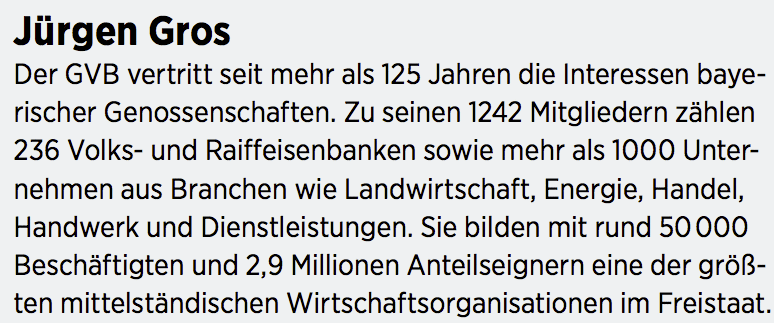

 Mein Konto
Mein Konto



